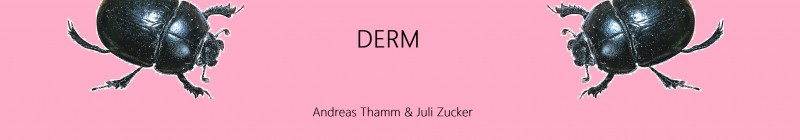Kürzlich gab es mal wieder ein echte Literaturdebatte. Florian Kessler schrieb in der Zeit über die Literaturinstitute und deren Studentenschaft aus privilegierten Häusern, in der Taz gab’s Erwiderungen und bei Facebook quollen die Pinnwände über, weil jeder andere Schreibschüler auch eine Meinung hat. Was Kessler sagt, dass nämlich viele seiner Kommilitonen aus der guten alten Zeit in Hildesheim die Söhne und Töchter von Ärzten und Immobilienhaien seien und dass wir es deswegen mit einer überprivilegierten Schicht der nächsten Literaten zu tun hätten, was möglicherweise nicht unerheblich sei für die braven (langweiligen), literarischen Produkte der Buben und Mädchen, die da Schreiben studieren in Hildesheim und Wien und Leipzig und Biel, ist ja sicher nicht ganz falsch. Einzig, die Art und Weise, wie erstens im Feuilleton und im sozialen Netzwerk mit dem Text an sich und zweitens mit dem Phänomen des „Erfolgs“ der Schreibschüler umgegangen wurde, ließ für einen Moment den Eindruck entstehen, die Autoren wüssten nicht, was jeder Sandkastenbub zwischen Wedding und Stuttgart weiß: Dass diese Absolventen, so sie denn tatsächlich veröffentlichen, eben nicht die Bestsellerlisten bevölkern, sondern sich im Gegenteil eher für ein prekäres Dasein qua Studium entscheiden (was ja sicher auch mit Netz und doppeltem Boden und Papas und Mamas Haus im Grünen mit unberührtem Kinderzimmer zu tun hat). So privilegiert sie also auch sein mögen, die Studenten, sie hätten einen Weg des geringeren Widerstandes und des höheren Auskommens wählen können.
Dass aber die Herkunft beziehungsweise eben die Berufe der Eltern etwas mit der literarischen Qualität der diversen erscheinenden und erschienenen Bücher zu tun haben, das ist so eine These, die interessant und überprüfenswert ist, was sich schon allein daran, dass so viele sich so laut dagegen wehren, schön ablesen lässt. Andererseits ist der Vorwurf auch nicht neu, eher anders formuliert. Vom fehlenden Leben in den perfekt konstruierten Texten war schon immer wieder mal zu lesen gewesen. Was das im Endeffekt heißen soll, weiß ich nicht, aber andersrum funktioniert’s: Ich weiß, dass ich das gefunden habe, das Leben, das die, die das gerne haben, immer gesucht haben, und zwar in den Texten, und jetzt kommt nach all dem Akademiegossip, der kein Schwein interessiert, der elegante Schwenk hinein in die Rezension, und zwar in den Texten einer jungen US-Amerikanerin, die, wie man lesen kann, zwischen dem New Yorker und dem Paris Review Literary Journal aufgewachsen sei, Tochter einer Dichtern, kein literaturfernes Milieu, aber wenigstens nie, auch wenn man es vermuten könnte, creative writing studiert hat. Heute gibt Ellen die Literaturzeitschrift Hobart heraus und schreibt Geschichten.
Fast Machine heißt der erste („richtige“), in den USA erschienene Band, Short Stories würde man in Amerika sagen, und in Deutschland auch, schließlich ist das irgendwie was anderes, als eine schnöde Kurzgeschichte. Und, zumindest so viel lässt sich sagen: Wenn man davon ausgeht, und das tue ich gerne, dass die bildfixierte Amerikanische Gesellschaft, sich als gefühltes Ganzes noch immer durch einzelne ikonische Klischees im Hirn des popkulturell geprägten Zentraleuropäers aufrufen lässt, dann handelt es sich um die amerikanischsten Geschichten, die ich vielleicht überhaupt kenne, weil sie so ein paar sehr schöne und sehr literaturtaugliche Dinge bestätigen. Es wird herrlich viel Whiskey gesoffen, es werden Münzen in Jukeboxen gesteckt, es wird Madonna gehört und Stevie Nicks, es gibt Vorstädte mit luftleeren Plastikbällen in der Garagenauffahrt, bärtige, wütende Männer in Unterhemden und so weiter und so fort. Wenn man Elizabeth Ellen mit Google-Bildersuche auf die Spur zu kommen versucht, sieht man sie direkt Billard spielen. Und so scheiße das Bild ist, gerät man kaum in Gefahr, das für eine strategisch motivierte Selbstinszenierung zu halten, wie man sie an der Uni lernen kann. Ist das nicht besonders wohltuend in einer Zeit, da jeder, der auch nur die ersten beiden Silben des Wortes authentisch in den Mund zu nehmen wagt, des Todes sei?
Andererseits, natürlich, ist es nicht über Nacht wieder 1960 geworden und Elizabeth Ellen ist niemand, der sich das wünscht. Ihr Blog ist ja letztlich auch genau das, die Selbstinszenierung in ungeschminktester Variante inklusive Pics mit Stars-and-Stripes-Bikini, völlig unverkrampft, weil die Ellen sich mehr so ugly on the inside findet. Und wer jetzt glaubt, besser kann’s eh nicht werden, ich zieh mir der ihren Blog rein, bis mir die Augen zufallen, der soll sich lieber mal das Buch kaufen, das da bei Schwarzkopf & Schwarzkopf erscheint, „Die letzte Amerikanerin“ (da haben wir’s schon wieder, Stars and Stripes und Billard, die Gute). Die letzte Amerikanerin ist die erste Übersetzung von Elizabeth Ellens Stories ins Deutsche, eine Auswahl der besten Geschichten, stets aus weiblicher und meist aus einer Art Froschperspektive. Es geht, wenn man versucht den Band zusammenzufassen, was nie ganz gelingen kann, um Mädchen, die einer konstantwährenden Bedrohung ausgesetzt sind, einer Situation ohne Schutzmechanismen, ohne FSK; extreme Abweichungen vom gesellschaftlichen Ideal unterm Filter von Alltäglichkeit und ewig problematischer Adoleszenz. Das mediale Sitcom-Madonna-Versprechen muss sich mit der realen Realität messen.
Die Ich-Erzählerin der ersten Story „Arizona“ beispielsweise hat Probleme einzuschlafen: Ihre Mutter stöhnt zu laut, wenn sie jede Nacht mit Mike fickt. Die Protagonistin selbst fühlt sich übergewichtig, sie kauft sich eine Gurke und erhitzt sie in einem Topf voll Wasser, damit sie sich „lebensechter“ anfühlt. „Die Gurke tut auch nicht weh. Sie fühlt sich irgendwie tröstlich an, wie eine Lieblingsdecke oder ein Kuscheltier. Und ich frage mich, ob sich so ein echter Schwanz anfühlt: warm und vertraut. Ich ziehe sie halb raus schiebe sie wieder rein. Ich horche nach meiner Mutter.“ So trocken und böse und explizit die Prosa auch sein mag, die Hoffnung auf irgendeine Form von Nähe besteht immer. Und: Sie ist nicht biestig, Ellen schreibt nicht mit hochgezogenen Lefzen, den Geschichten ist der Spaß an ihrer Produktion anzumerken. In der Story „Geschwisterliebe“ lernt Erin ihren Vater und ihre Halbschwester Leanne kennen. Man hängt am Pool ab, schaut fern, bewundert die Freaks im Guiness Buch der Rekorde, Erin zwingt Leanne ein wenig zu ersten sexuellen Erfahrungen und raucht ihre erste Zigarette: „Ich nahm einen Mundvoll Rauch und hustete, und der Rauch kam wieder raus und füllte die Höhle. Ich warf einen Blick zu Joel, der ähnlich hart daran arbeitete, das Rauchen wie eine gewöhnliche Beschäftigung aussehen zu lassen.“
Natürlich: Ein Mädchen, das sich eine Gurke reinschiebt, ein anderes, das eine erste Zigarette pafft, das sind keine literarischen Novitäten. Und wenn Ellen beschreibt, wie das Mädchen aus Geschichte eins, sich in Geschichte zwei in den brutalen Hackordnungen am Internat behaupten muss, denkt man unweigerlich an diverse Filme, die man vielleicht gar nicht gesehen hat. Vielleicht aber funktionieren die Geschichten, bis auf wenige Ausnahmen, gerade deshalb so gut. Weil Sprache und Konflikte zwar radikal sind, gleichzeitig aber vertraut und ehrlich. Ellen collagiert eine unbehagliche Welt, die aber so weit nicht entfernt zu sein scheint. Die Hoffnung auf kindliche Unschuld wird darin immer wieder brutal zerschmettert. Ein Mädchen macht sich Gedanken über das, was die Mutter von ihren wechselnden Freunden bekommt: „Das Mädchen bemerkte diese Bedürfnisse der Mutter und verabscheute sie. Sie verabscheute sie, weil sie nicht in der Lage war, sie zu befriedigen. Sie verabscheute sich selbst, weil sie kein Mann war. Sie verabscheute die Männer, weil sie der Mutter geben konnten, was sie selbst ihr nie würde geben können, nicht mit all ihren Zeichnungen und missgebildeten Vasen und geflüsterten Ich-liebe-Dichs.“ Auf die titelgebende Zahnfee wartet die Protagonistin dieser Geschichte vergeblich.
Die Protagonistin der Story „Wie ich aufhörte, Dave Eggers zu lieben und euch den Master-Abschluss stahl“ heißt Elizabeth Ellen. Es ist der eine Text, der ganz anders ist als die anderen, ein experimenteller Meta-Spaß über Stalking als Kulturform. „Rückblickend glaube ich“, schreibt Ellen, „dass der Blickkontakt dort auf dem Bürgersteig den Ausschlag gegeben hat. Meide jeglichen Blickkontakt zu einem potenziellen Stalker.“ Das ist dann insgesamt eine auf die literarisch-autorenreferentielle Spitze getriebene Selbstironie, ein Comic-Relief in diesem sorgsam zusammengestellten Band. Eine erste Leseprobe hat die Zeit veröffentlicht.