Ich möchte bitte keine Mautstraßen mehr fahren. Ich quäle den Kangoo über die Berge im Hinterland Kroatiens, scenic route. Auf Google Maps kann ich mich fast zu einhundert Prozent verlassen. Google weiß, wo ich bin und lässt mich zwischendurch schon mal eine enge Schlaufe fahren, damit ich sehe, wie sie hier heiraten, zwischen Betonpfosten am Straßenrand. Man schickt mir verwunderte Blicke nach. Auf der Straße trocknet eine überfahrene Schlange fest.
Wenige Kilometer weiter überquere ich die erste Grenze, die wirklich eine Grenze ist. Denn Bosnien-Herzegowina gehört nicht zur EU.
Green card, sagt die Frau in dem kleinen Grenzhäuschen und ich gebe ihr zuerst mal den Fahrzeugschein und sie sagt: No, no insurance card und wenn ich die nicht zufälligerweise wegen der Kupplungspanne gerade erst gebraucht hätte, wüsste ich so gar nicht, was sie von mir will.
Ein echter Grenzübertritt, inklusive Herzklopfen und finster dreinschauenden Soldaten und der Unsicherheit, dem stillen Zweifel, wenn die Schranke dann aufgeht, ob es das denn nun wirklich war. Darf ich rein? Jo.
Und dann kommt sogleich die Nachricht vom Netzanbieter: Herzlich willkommen in Bosnien und Herzegowina, hier gibt’s keine mobilen Daten für dich, wobei doch, du kannst irgendwie 16 Mb kaufen für 2 Euro, aber ansonsten fuck you.
Bosnien-Herzegowina ist das erste Land dieser Reise, das ich zum ersten Mal betrete. Dritthöchste Arbeitslosigkeit der Welt, bettelarm, vom Krieg zerfetzt und teils liegen gelassen. Und man neigt dazu, davon auszugehen, dass damit, dass man diese Grenze hinter sich lässt, auf einmal alles anders wird, sich links und rechts der Boden auftut, willkommen in der dritten Welt.
So ist das natürlich nicht. Stattdessen eröffnet sich hier in der südlichen Herzegowina zum einen eine malerische Hügellandschaft. Alles ist grün, nur der Himmel ist blau und die Hölle scheint weit weg. Zum anderen kommt eh kaum das Gefühl auf, dass man sich in einem anderen Land befindet, weil in jedem Dorf, an jeder Kneipe, an jedem Stall die Flagge mit dem Schachbrettmuster hängt, die kroatische oder gar die der nichtexistenten Teilrepublik Herceg Bosna, das kann ich im Nachhinein nicht mehr sagen.
Diese roten und weißen Würfel jedenfalls sind ein erster Hinweis darauf, wie kompliziert das hier alles ist in Bosnien-Herzegowina, dem Dreivölkerstaat. Hier leben katholische Kroaten, muslimische Bosniaken, orthodoxe Serben – was auch immer das heißt! – und sie lebten hier friedlich, vorbildhaft, solange das alles hier sozialistisches Jugoslawien war, solange alle Tito liebten und der Nationalismus irgendwie gedeckelt war.
Kein Wunder also, dass als dann Anfang der 90er-Jahre alle Deckel von allen Töpfen flogen, der Krieg hier am blutigsten wütete. So viel weiß ich. Aber ich habe noch gar nix verstanden, als ich diese Grenze hinter mich bringe, rein in dieses Paradies, vorbei an dieses Flaggen, die sicher alles sind, aber nicht die Bosnische.
Ich bin auf dem Weg nach Mostar, aber ich kann die Schilder nicht ignorieren, die in Richtung Medjugorje weisen.
Dieser Ort sagt niemandem etwas, außer denen, die sich mit angeblichen Erscheinungsorten der Gottesmutter Maria auseinandergesetzt haben. Und wie ich bereits in Teil fünf dieses Berichts erläuterte, ist das irgendwie mein Thema. Und obwohl ich weiß, dass Medjugorje nicht unbedingt zu den sehenswerten Orten in Bosnien-Herzegowina gehört, steuere ich den Kangoo genau dort hin.
Ganz kurz zur Geschichte: Am 24. Juni stehlen sich sechs Jugendliche auf einen Hügel vor Medjugorje davon, um heimlich zu rauchen. Hier erscheint ihnen Maria erstmals, dann täglich, mittlerweile, etwas dosiert, nur noch monatlich. Am 25. jeden Monats veröffentlich das örtliche Informationszentrum eine neue Botschaft. Medjugorje ist unter den vielen Wallfahrtsorten dieser Art quasi der aktive Vulkan. Hier gibt’s noch was zu sehen – und zwar so, dass man die Uhr danach stellen kann. Herrlich.
Das Interessante an Medjugorje ist erstens der geographische Ort: Die angeblichen Erscheinungen finden im katholisch-kroatischen Landstrich innerhalb der muslimisch dominierten Teilrepublik des sozialistischen Jugoslawiens statt. Maria sagt einen blutigen Krieg auf dem Balkan voraus. Die jugoslawischen Behörden verfolgen die Seher, die in ein Kloster der Franziskanermönche fliehen. Später werden sie in die psychiatrische Anstalt in Mostar eingeliefert. Widerrufen aber wollen sie nicht.
Die Erscheinungen werden dadurch zu einer Art Waffe in einem Krieg, der noch nicht begonnen hat. Auf einmal haben die Katholiken etwas, das weder Muslime noch Orthodoxe vorweisen können: Ein Wunder.
Zweitens die Wirkung: Medjugorje ist in den 80er-Jahren ein absolut unbedeutendes Kaff im europäischen Niemandsland. Hier leben knapp 2000 Menschen. Die Gottesmutter Maria hat aus diesem Kaff einen der populärsten Pilgerorte weltweit gemacht, etwa eine Million Menschen kommen pro Jahr hier her. Teilweise predigen mehr als 7.000 Geistliche parallel. Angeblich ziehen weder Mostar noch Sarajevo mehr Übernachtungsgäste an. Wundersame Erscheinungen sind ein Tourismusmagnet und empfehlenswert für jedes Örtchen in jeder strukturschwachen Region. Man muss als Seher nur konsequent genug sein. Dass der Vatikan die Erscheinungen bis heute nicht anerkannt hat, ist für die Wirkung irrelevant.
Ich komme nicht an einem Feiertag, nicht an einem Erscheinungstag hier her, es ist einfach irgendein Dienstag oder Mittwoch und trotzdem finde ich im Zentrum, nahe der imposanten Jakobuskirche, erstmal keinen Parkplatz.
Fast-Food-Stände säumen meinen Weg, Klosterschwestern und Reisegruppen und Busse schieben sich vorbei. Und genauso wie der Stand mit den gefälschten Fußballtrikots an jeden Strand gehört, gehören hier her die Shops, einer neben dem anderen, mit den Marienfiguren, den Kerzen, den Büchern und Bildern und Rosenkranzketten. Hier, ein Erlösungssouvenir. Und gefälschte Fußballtrikots bekommt man trotzdem, ist ja WM, Modric hängt da und James, also alles gut.

Ich fahre einen Halbkreis durch dieses Zentrum und bin schon jetzt, obwohl noch nicht mal ausgestiegen, einigermaßen genervt. Ich weiß, dass ich das hier gesehen haben muss, aber es widert mich an, vom ersten Moment an. Und eigentlich bin ich schon auf verschlungenen Pfaden zurück in Richtung Bundesstraße unterwegs, denke ich, als ich doch noch einmal abbiege, weil da nun einmal ein Schild in Richtung Erscheinungshügel weist.
Auf dem Parkplatz am Fuße des Erscheinungshügels lasse ich den Blick über Weinberge schweifen und esse eine Nektarine und ihr Saft saftet mir die Hand ein und das ist ein Problem.
Das Schild weist von hier eine enge Straße hinauf. Hier gibt es links und rechts wirklich nichts anderes mehr als die typischen Souvenirläden. Die sich alle, alle irgendwie rechnen müssen. Aber wenn man vorbeikommt, sieht man nie einen Pilger, der etwas kauft und die Verkäuferinnen lümmeln lässig im Hintergrund, rauchen und ratschen.
Und ich bin hier und eigentlich nicht zu unterscheiden von allen anderen, auch wenn ich kein Kreuz um den Hals trage und kein Rosenkranz durch meine Finger wandert. Auf dem Hügel ist vergleichsweise wenig los, denn der Weg hinauf zum eigentlichen Erscheinungsort, dorthin, wo die sechs Kinder doch eigentlich nur in Ruhe rauchen wollten, ist so belassen: Keine Treppen, nur rötlich braune Felsen. Ich wackle in Birkenstock hinauf bis zum Kreuz. Man hat eine schöne Aussicht. Blondierte Damen folgen mir in stiller Versenkung.
Später entdecke ich auch noch den Parkplatz hinter der Kirche. Jetzt hat das Ganze einen Sog entwickelt. Ich stehe vor Geländekarten, hier Freialtar, dort Kreuzgang, da lang zur Beichte. Ich sehe Kennzeichen aus Kroatien, Slowenien, Deutschland. Und ich höre, mikrophoniert, verstärkt, die säuselnde Stimme eines Priesters, die über die Amphitheater-artig angelegten Bänke schallt und in unendlicher Wiederholung Maria anbetet und preist, davon zumindest gehe ich aus.
Man könnte gut noch ein paar hundert Leute unterbringen an diesem späten Nachmittag, aber das heißt nicht, dass nicht schon ein paar hundert da wären. Und wer nicht sitzen mag, der kniet und breitet die Arme aus. Ein bisschen Ekstase ist immer drin in Medjugorje. Ich streife beobachtend durch die Reihen und fühle mich gleichzeitig beobachtet von einem jungen Mann mit sanftem Gesicht, dem etwas wie ein Ausweis um den Hals baumelt und der entweder auch wie ich durch die Reihen streift, oder wegen mir durch die Reihen streift und mich irgendwann fragen wird, warum ich fotografiere, ob er mir helfen könne.

Ich flüchte mich hinter die Kirche, wo etwas noch Erstaunlicheres stattfindet: Open-Air-Beichte. Priester dürfen nach Medjugorje eigentlich nur als Privatpersonen kommen, wenn das noch der aktuelle Stand ist. Klar ist, es kommen einige und die stellen dann hier, hinter der Kirche, einen Stuhl auf und ein oder mehrere Kärtchen, auf denen die Sprachen stehen, die sie beherrschen. Vor dem, der Serbokratisch, aber auch vor dem der Deutsch beherrscht, haben sich bereits lange Schlangen gebildet und die glotzen dann gemeinschaftlich zu, wie da von Stuhl zu Stuhl gebeichtet wird.
Auch das betrachte ich einige Minuten.
Ich weiß, dass es sich gelohnt hat, hier her zu kommen, denn Medjugorje ist tatsächlich so ein Ort, wie es ihn auf der Welt kein zweites Mal gibt. Ein Kuriosum. Man kann hier überall stehen bleiben und sich das Schauspiel ansehen, ein Schauspiel das nie aufhört und morgen so aussehen wird, wie es heute aussieht, aber doch nicht identisch.
Und dann muss ich hier weg. Denn es ist interessant, all das zu sehen aus einer gewissen Distanziertheit heraus, aber mit der Zeit, und nun bin ich vielleicht bald zwei Stunden hier, greift es mich direkt körperlich an.
Medjugorje mag geil kurios und irgendwie mystisch sein und all das, vor allem aber spirituelle Massenabfertigung und Geldmache mit naiver Leichtgläubigkeit. Alles, was da dazugehört prasselt hier auf mich ein. Ich bekomme einen flauen Magen und komische Gedanken. Ich muss weg, ich muss weiter. Servus, Maria.

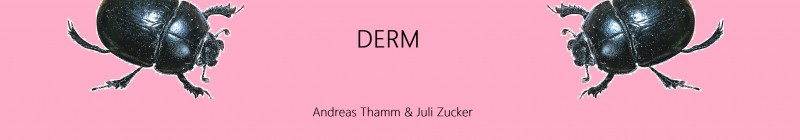



 Und deshalb, so müsste man meinen, hat die Gottesmutter ausgerechnet hier Hand an meine Kupplung gelegt. Wenn man glaubt, dass es sie gibt und sie sowas kann zumindest. Und wenn ja, dann hätte sie doch einen ganz guten, augenzwinkernden Humor, mit dem sie mir sagt: Zieh dir rein, was die Leute machen in ihrer Verrücktheit, zu der doch nur Glaube befähigt.
Und deshalb, so müsste man meinen, hat die Gottesmutter ausgerechnet hier Hand an meine Kupplung gelegt. Wenn man glaubt, dass es sie gibt und sie sowas kann zumindest. Und wenn ja, dann hätte sie doch einen ganz guten, augenzwinkernden Humor, mit dem sie mir sagt: Zieh dir rein, was die Leute machen in ihrer Verrücktheit, zu der doch nur Glaube befähigt.



































