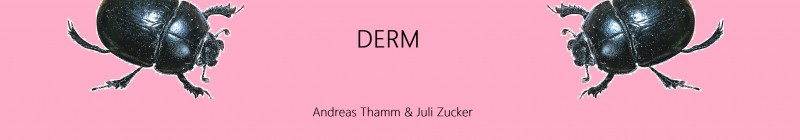Es gibt so ein paar Binsenweisheiten, die einem immer wieder begegnen, wenn es um Kriterien tatsächlich großer Popmusik geht. Von Herzen soll sie kommen, authentisch soll sie sein. Beides sind eigentlich gar keine Aussagen. Und zeitlos, sie soll irgendwie zeitlos sein, die Popmusik, sie soll sich bewähren über die Jahre und gut altern, um als relevant und, ja, als groß gelten zu können. Und da ist wohl wirklich was dran.
Ich glaube, es gibt wenige Künstler, deren Songs das Moment der Zeitlosigkeit wirklich zuverlässig heraufbeschwören können. Pete Seeger beispielsweise oder Woody Guthrie kann ich, Jahrgang 90, sicher nicht genauso empfinden wie der Working Class Hero aus Michigan 19-irgendwas-mit-50. Sie sind museal geworden. Es gibt andere, die vor diesem Schicksal gefeit sind. Und Leonard Cohen ist einer von ihnen.
Es ist nicht übertrieben, zu sagen, dass ich zu einer der ersten Generationen junger Menschen gehöre, deren Eltern bereits mit dem aufgewachsen sind, was wir Popmusik nennen. Und bis zu einem gewissen Grad waren meine Eltern wirklich begeisterte Musikhörer. Sie sind es bis heute. Nur das Zeitgenössische ist irgendwann aus dem Fokus gerückt, als schlicht und einfach die Zeit fehlte, sich weiterhin mit den neusten, heißen Platten zu beschäftigen. Die musikalische Sozialisation meiner Eltern reicht nur in etwa bis in die Mitte der 70er-Jahre – bis meine beiden Schwestern geboren wurden. Popmusik und der Ernst des Lebens haben sich noch nie besonders gut vertragen.
Auch meine eigene musikalische Sozialisation hängt natürlich nicht unwesentlich mit den Vorlieben meiner Eltern zusammen. Es ist ein Prozess, der sich ganz gut mit genau zwei Schlagworten überschreiben lässt. Pubertäre Ablehnung und: Plätzchenbacken.
Heute, aus der Distanz eines guten Jahrzehnts, kann ich reinen Gewissens sagen: Ich schäme mich meiner pubertären Ablehnung nicht. Ich glaube vielmehr, dass es sich bei dieser Phase um einen essentiellen Bestandteil einer gesunden Persönlichkeitsentwicklung handelt. Natürlich weiß ich heute, dass es Linkin Park in keiner einzigen Kategorie mit Led Zeppelin aufnehmen können. Dass ich sie damals mit jugendlichem Furor gegen das alte Genöle des Robert Plant verteidigt habe, war trotzdem richtig. Irgendwas war da eben an diesem In The End, das mich sofort aufs Fahrrad steigen und in den Müller-Drogeriemarkt fahren ließ, um dieses Album zu kaufen. Und dass Chester Benningtons Geschrei meinen Eltern nicht gefiel, hatte daran sicherlich auch einen kleinen Anteil.
Das ist eine alte Geschichte. Mein Vater drehte in seinen Tagen der pubertären Ablehnung Pink Floyds Careful With That Axe Eugene in seinem Zimmer auf, besonders laut an der Stelle, wo die Axt, von der da die Rede ist, tatsächlich zum Einsatz kommt, woraufhin meine Großmutter, angeblich jedes Mal, entsetzt ins Zimmer stürzte, um nachzusehen, was da los sei. Ich weiß nicht, welche Musik meine Oma gehört hat, und ob überhaupt. Meine Form der musikalischen Selbstbehauptung war weitaus harmloser. Ich legte die Hybrid Theory im elterlichen Wohnzimmer auf und beharrte, dass das eben besser sei, als Pink Floyd, Led Zep, Iron Butterfly. Ich erntete Spott und Unverständnis. So wie es sich gehört, so wie es sein muss.
Es ist eine durchchoreographierte Angelegenheit, die ich mit meinen Kindern, so ich irgendwann welche haben sollte, in bewährter Weise nachexerzieren werde. Die ganze Wiederaufbereitungslogik der Retro-Wellen verleiht dem Schauspiel zwar eine etwas absurde Note, macht es aber nicht weniger notwendig.
Wenige Jahre vor Linkin Park und System Of A Down war ich noch empfänglicher gewesen für das, was die Eltern mir an altem Zeug als gute Musik auftischten. Zumindest, wenn das Auftischen mit dem Ritual des vorweihnachtlichen Plätzchenbackens einherging. Ich glaube, gehört zu haben, dass der Geruchssinn am engsten mit den Erinnerungszentren im Gehirn verknüpft ist. Vielleicht liegt es daran, dass die Melodien, die ich hörte, während ich von Zimt- und Nelkenschwaden umweht wurde, einen außergewöhnlich nachhaltigen und ungewöhnlich emotionalen Eindruck hinterlassen haben.
Das heißt nicht, dass mir grundsätzlich alles gefiel und noch heute gefällt, was Mama da in den CD-Player schob, bevor sie den Teig ausrollte. Mit dem wehleidigen Geheule einer Joan Baez kann ich heute so wenig anfangen wie damals und ich hasse – ja, hasse! – Cat Stevens, nach wie vor, unvermindert, für immer (mit Ausnahme einiger Songs vom 2014er-Album, auf dem er auf einmal nicht mehr wie ein Ziege in zu engen Cordhosen singt).
Reinhard Mey hingegen versorgt mich mit angenehmen Nostalgieschüben. Und Leonard Cohen steht für immer auf sämtlichen Podesten. Die Musik auf seinen frühen Alben ist für mich die Kristallisation der Zeitlosigkeit.
Ich sehe sie vor mir, es ist 1974, Heidi Thamm sitzt im Coburger Schwesternwohnheim und raucht heimlich Pfeife, nicht weil sie gerne Pfeife raucht, sondern weil sie es mag, wie sie aussieht, wenn sie heimlich Pfeife raucht. Ein schwerer, süßer Rauch hängt in dem kleinen Kabuff. Wahrscheinlich sitzt sie auf dem Boden, ich hoffe, dass sie auf dem Boden sitzt, vielleicht sogar auf einem alten Perser. Sie darf die Musik nicht zu laut aufdrehen, wegen der Oberschwester. New Skin For The Old Ceremony. Chelsea Hotel #2.
I don’t mean to suggest, that I loved you the best / I can’t keep track of each fallen robin / I remember you well in the Chelsea Hotel / That’s all, I don’t think of you that often
Und es gibt nicht sehr viel, was sie von mir unterscheidet, wie ich 40 Jahre später in meiner kleinen Wohnung sitze und sicher nicht Pfeife rauche, aber vielleicht eine Zigarette und möglicherweise (es liegt viel Schönheit in der Unmöglichkeit, darüber eine Aussage zu treffen) dasselbe Gefühl für die unfassbare Tiefe dieses Songs bekomme, wie sie damals. Es sind nicht nur Cohens Worte. Meine Mutter hat erst viel später damit begonnen, sich mit Cohens Texten auseinanderzusetzen und ist dabei zu dem Schluss gekommen, dass das oft ein rechter Schmarrn sei. Und als ich damals Plätzchen buk, war ich, sagen wir, acht Jahre alt. Ich habe maximal die Worte Hotel, all und I verstanden.
Und dass robin Rotkelchen heißt, weiß ich seit etwa zwei Minuten. Janis Joplin als Rotkelchen, okay.
Damals war das eine schlichte Melodie auf der Gitarre und der ein wenig lustlos genuschelte Gesang eines Mannes mit schmalem Gesicht und traurigen Augen. Heute gehört Chelsea Hotel zu den wenigen Songs meines Lebens, die über die Jahre zu einem emotional aufgeladenen Konstrukt geworden sind, zu einer Idee von einem Song, der auch etwas mit mir zu tun hat, mit dem Achtjährigen mit mehligen Händen, der es einfach nicht verstehen kann, warum man den Teig backen muss, wenn er roh doch viel besser schmeckt. Und mit dem 22-Jährigen, der mit dem ersten eigenen Auto und der ersten richtigen Freundin durch Slowenien und nach Kroatien fährt.
Es ist immer wieder Leonard Cohen. Ich will nicht so tun, als hätte ich das von Anfang an begriffen. Ich war schon in den Jahren vor der Pubertät ein Kind, das sich selbst zu einem gewissen Teil durch Ablehnung selbst legitimierte. Störrisch, stur, oft zornig. Nur was ich selbst mochte, galt unbedingt. Und es gab eben auch die im Nachhinein etwas peinlichen Momente, in denen ich diesen Säulenheiligen des Hauses Thamm beleidigt habe, gesagt habe, dass das langweilig sei, immer das gleiche, immer depressiv (ein Wort, das ich aufgeschnappt haben muss).
Aber das hat letztlich mehr mit der Ablehnungsgeste an sich zu tun, die ich ausprobieren musste, um herauszufinden, wer ich selbst werden konnte, als mit dem Objekt, auf das ich mich bezog, der Musik eines traurigen Kanadiers.
Cohen litt immer wieder an Depressionen und es ist offensichtlich, dass sich das auf seinen Alben mal mehr, mal weniger niederschlägt. Sein drittes Album Songs Of Love And Hate von 1971 gilt als sein emotionalstes. Und ist deshalb sein stärkstes. Cohen funktioniert dann am besten, wenn er anrührt, wenn er sich seinen Hörer greift und ganz nah an die dünnen, zitternden, nach Rauch stinkenden Lippen zerrt.
New York is cold, but I like where I’m living / There’s music on Clinton Street all through the evening
Dieser Ich-Erzähler in Famous Blue Raincoat, der behauptet, es gefalle ihm, wo er untergekommen sei und sich dabei so niedergeschlagen anhört, dass es unmöglich wird, ihm zu glauben. Das Negative in Cohens Musik ist nie ein Aufschrei, da sind nie Fäuste die gegen Wände hämmern – oder überhaupt Fäuste. Leonard Cohen ist der Poet der Niedergeschlagenheit, des stillen Sitzens und auf den Boden Schauens, der Resignation, der Erschöpfung, der offenen Handflächen, letztlich: der Kapitulation.
Famous Blue Raincoat ist dabei aber viel mehr als das. Es ist nicht einfach nur Ausdruck einer Emotion, sondern Storytelling. Von Cohen heißt es (in einer dieser Dokus), er wäre eben zuerst Literat gewesen und nachrangig Musiker, genau andersrum wie bei Dylan. Das ist das Falscheste. Das Gegenteil ist richtig. Dylan ist der Erzähler, dem es nur in Ausnahmefällen gelungen ist, seine überwältigende Poesie in gleichrangige Songs zu kleiden, während der Famous Blues Raincoat jeden anrührt, egal ob die Dreiecksbeziehung, die Cohen darin verhandelt, nachvollzogen wird oder nicht.
Der Text kann als Abschiedsbrief gelesen werden. Gleichzeitig gibt es relativ eindeutige Scientology-Anspielungen. Cohen, Sinnsucher, später Teilzeit-Mönch, mischte Anfang der 70er auch bei denen ein wenig mit. Im Nachhinein sagte er, er wäre dort Mitglied geworden, weil er gehört habe, es sei einfach, dort Frauen kennenzulernen.
Es spielt letztlich keine große Rolle. Ich erinnere mich: Mutter Thamm mit der Schürze um die Hüften und draußen schneit es vielleicht sogar schon, wahrscheinlich nicht, und eigentlich will ich gar nicht so gerne Plätzchen ausstechen, es macht mich müde, ich will nur naschen. Und dann setzt dieser Chorus ein, Worte, die Cohen mehr loswird, als dass er singt, als würde er sie atmen. Und Mama singt mit, zwei, drei Oktaven zu hoch, künstlich, irgendwie ironisch, aber vielleicht deshalb gut.
And Jane came by with a lock of your hair / she said, that you gave it to her
Das ist so verflucht wenig. Im Grunde reicht schon der Jane-came-Reim alleine. Das ist die Stelle, die sich festhakt, im Ohr des Achtährigen, des Fünfundzwanzigjährigen, der Fünfzigjährigen, die aus einer vertonten Short-Story einen eingängigen Popsong macht.
Ich habe einen guten Freund, der in Würzburg seinen Bachelor in Musikwissenschaft gemacht hat. Das Studium war für ihn selbst relativ sinnfrei. In keiner Zeitung steht bei den Stellenangeboten jemals: Suchen dringend Musikwissenschaftler. Es ging ihm wie vielen Geisteswissenschaftlern. Um wenigstens noch einen guten Spruch zu retten, damit das Ganze nicht absolut umsonst war, sagt mein Freund: Es habe sich insofern gelohnt, als es ihm Autorität verleiht. Wenn er sagt, dieser oder jener Song sei Mist, könne man sich jede Diskussion sparen, denn in diesem Moment wäre das dann wissenschaftlich belegt. Das ist eigentlich ziemlich klug. Vor allem weil wir ja wirklich immer irgendwie auf der Suche nach Kriterien sind, nach etwas, woran wir uns festhalten können, etwas, das über das ewige Geschmacksurteil hinausgeht.
Das ist Geschmackssache: Dieser Satz muss einfach verboten sein.
Aber es gibt ihn natürlich schon, den Geschmack. Und auch wenn wir aus Trotz und spätpubertärer Laune oft so tun, als sei das Gegenteil der Fall – der Musikwissenschaftler und ich haben eigentlich einen recht ähnlichen. Wir sind uns zumindest insofern einig, als dass wir der Meinung sind, einen wirklich großen Song ohne Melancholie könne es gar nicht geben.
Einen Leonard Cohen Song ohne Melancholie gibt es nicht. Was auch immer sich tatsächlich hinter diesem Abstraktum verbergen mag – wir haben alle eine ungefähre Vorstellung davon. Ich kenne neben Leonard Cohen und Nick Drake keinen dritten, der dieses komplexe und furchtbar schwammig-undeutliche Was-auch-immer so präzise mit Noten angesteuert und getroffen hätte.
Ich bin dafür immer empfänglich gewesen. Keine Ahnung, ob ich ein schwermütiges Kind war oder so, träge, lethargisch sicherlich. Es gibt diese Geschichte, die meine Mutter gerne erzählt. Sie habe Lego geliebt. Stundenlang habe sie mit mir auf dem Fußboden gesessen, um die schönsten Dinge zu bauen – Häuser, Schlösser, Wohnwägen, Flugzeuge. Ich hingegen – so erzählt das zumindest meine Mutter – saß nur daneben, untätig, wie gelähmt, und sagte am Ende auch noch, wie zum Spott: „Ja, schön.“
Sting mochte ich auch gerne. Das lag an meiner Schwester, die im Gegensatz zu meinen Eltern, den Draht zu den heißen Platten der End-80er und frühen 90er-Jahre hatte. Sie war es auch, der es gelang einen kleinen Keil des Zweifels in meine New-Metal-Obsession zu schlagen, indem sie mir Californication der Red Hot Chili Peppers auslieh. Sting jedenfalls. Auch ein Melancholiker im weitesten Sinne, wenn auch eher von der heiteren Sorte.
Englishman in New York ist kein Song, an den man als Mittzwanziger 2015 oft denken würde. Wenn meine Schwester am Plätzchenbacken teilnahm, bekam man diesen Song oft zu hören. Und im Radio läuft er ja nach wie vor nicht gerade selten. An der Stelle, wo Sting jault Oh, oh, I’m an Alien, I’m a legal Alien plärrte ich stets Oh, oh, I’m a Leberwurscht, meine unverwechselbare und eindeutig bessere Version der Lyrics. Ich verstand kein Englisch, klar, und trotzdem ist das alleine schon ein wenig verwunderlich: Alien und Leberwurscht haben phonetisch gesehen nicht allzu viel miteinander zu tun.
Es ist mir mittlerweile gelungen, zu rekonstruieren, woran das liegt. Nicht an Sting nämlich, sondern an Paul McCartney, der sechs Jahre nach Englishman in New York, 1993 nämlich, mit Hope of Deliverance einen entsetzlichen Hit landete. Im Chorus dieses Songs findet der Leberwurscht-Platzhalter seinen Ursprung in den titelgebenden Worten: We live in hope of the Leberwurscht / From the darkness that surrounds us. Das ist weitaus weniger absurd. Es hört sich wirklich so an, als würde McCartney Leberwurscht statt deliverance singen. Der kleine Andreas fand das anscheinend so unfassbar lustig, dass er fortan versuchte, das Prinzip auch auf andere Songs anzuwenden. Zum Beispiel beim Plätzchenbacken. Zum Beispiel auf Englishman in New York. Mit Erfolg.
Jahre später läuft Hope of Deliverance mal wieder im Autoradio. Ich fahre, der Beifahrer ist ein guter Freund, ein Drummer. Vielleicht sage ich: „Fürchterlicher Song.“ Woraufhin er mir die Geschichte erzählt, dass er den Text früher, als er noch kein Englisch konnte, immer falsch verstanden hätte…
Haben wir beide tatsächlich denselben unwahrscheinlichen Blödsinn verstanden? Oder überlappen hier unsere Erinnerungen, weil sie mittlerweile etwas Schwammiges, Unzuverlässiges geworden sind, sodass sich der eine die spezifische Geschichte aus der Vergangenheit des anderen einverleibt hat?
So oder so – bis auf diese kleine Anekdote spielen heute weder Sting, noch der, zumindest 1993, unerfreulich unmelancholische McCartney, in meinem Leben eine große Rolle.
Leonard Cohen hingegen ist dageblieben. Auch zu Zeiten, als ich das Plätzchenbacken längst verweigerte, zu Zeiten der pubertären Ablehnung. Ich glaube, wenn Cohen mich nicht in dieser speziellen Phase begleitet hätte, wäre ihm dasselbe Schicksal beschieden gewesen wie Sting.
Es ist das Alter zwischen 14 und 18, in dem man Cohen wirklich verstehen kann – eben auch ohne die Texte zu übersetzen. Die Pubertät hat die Kraft aus einem lethargischen und zornigen Sohn einen echten Melancholiker zu machen. Ich hörte Cohen eher heimlich, um meiner Mutter nicht den Triumph zu gönnen – eine fatale Auswirkung der Konkurrenzsituation, die sich aus dem New-Metal-Disput ergeben hatte – und am liebsten natürlich in Zeiten des ausgeprägten Herzschmerzes. Die erste unerfüllte Liebe, die erste Trennung. Leonard steht dir bei.
Dabei sind seine Songs gar nicht so unterkomplex und niedrigschwellig, wie man es vom klassischen Herzschmerzsong, der ein Moment der Identifikation verlangt, kennt. Für das bisschen Identifikation reicht auch Everlong von den Foo Fighters.
And I wonder / When I sing along with you / If anything could ever feel this real forever / If anything could ever be this good again
So geht Teenager-Emotion. Das ist gar nicht abwertend gemeint. Teenager-Emotionen sind etwas Wunderbares und Everlong ist ein fantastischer Song. Aber Cohen-Songs sind differenzierter, erwachsener, weniger Sehnsucht als Bitterkeit, weniger Aufbegehren als Desillusion. Es mag daran liegen, dass ich, als es dann wirklich drauf ankam, dann doch zu Jeff Buckleys zugänglicherer Version von Cohens Hallelujah griff. Beziehungsweise: Auf die Datei klickte, am Computertisch unter der Dachschräge im Elternhaus, heulend. So oder so: Buckleys Version transportiert über den Gesang zwar eindeutig Klage – Cohens Lyrics sind aber im Gegensatz zu denen von Dave Grohl nicht eindeutig zuordenbar, sondern angereichert mit christlicher Mystik, irgendwie verworren, kryptisch.
Erst nach Überwindung der Pubertät gelang es mir, auch eine andere Seite von Leonard Cohen anzuerkennen. Und das hat vor allem damit zu tun, dass meine Eltern mir irgendwann eröffneten, es gebe da noch so einen Sparvertrag, ich könnte mir doch mal ein Auto kaufen (ich lebte und studierte im 400 Kilometer von der geliebten Heimat entfernten Hildesheim). In meinen besten Jahren hatte ich also beides, was man zum Glücklichsein braucht: Ein Auto und eine Frau, die gerne mit mir im Auto wohin fahren wollte. Das Auto erlaubte mir nämlich nicht nur zu pendeln, sondern auch zu reisen, bevorzugt gemeinsam mit ihr.
Gemeinsame Reisen sind immer Zeitabschnitte, in denen man Musik intensiver und emotionaler hört und kennenlernt. Während wir auf den Azoren vor unserem Zelt versuchten, im Regen den Gaskocher zu bedienen, verliebten wir uns beide in David Bowies Ziggie Stardust And The Spiders From Mars. In den Birkenwäldern an der Mecklenburgischen Seenplatte schmalzte uns Sam Cooke ins Ohr. Gemeinsame Erinnerung, besondere Orte, das wertet die Musik selbst auf. Besonderen Künstlern gelingt es, Songs zu schreiben, die wie Gefäße sind für diese Erfahrungen.
Leonard Cohen gehört nicht an einen Ort. Er gehört ins Auto. Ich hatte einen Mix für die vielen langen Autofahrten zusammengestellt. Ich genoss es sehr, meiner Freundin Musik zu zeigen, die sie noch nicht kannte und ich freute mich, wenn sie ihr gefiel. Manchmal gelang das erst durch wiederholtes Hören und gleichzeitiges Argumentieren. Der Opener einer dieser Mix-CDs funktionierte sofort. Das war So Long Marianne.
Oh, you are really such a pretty one / I see you’ve gone and changed your name again / And just when I climbed this whole mountainside / to wash my eyelids from the rain
Auch dieser Song ist bitter am Ende. Aber vorher kommt dieser Chorus, den man fast schon euphorisch nennen kann. Es ist ein seltsamer Song, Cohen leiert teilweise, dazu dieser kindliche Background-Chor. Geil, obwohl alles dagegen spricht. Und auf eine ebenfalls kindliche und wahnsinnig entzückende Art bettelte meine Freundin: „Nochmal Marianne!“, was zu einem dieser geflügelten Aussprüche der Beziehung wurde, etwas das sie wiederholte, weil sie wusste, dass wir beide uns daran erfreuen. Und weil sie den Song gerne oft hören wollte.
Bei vielen Künstlern gibt es eine Kluft zwischen dem Musiker und dem Menschen. Ich behaupte, bei Cohen gibt es sie nicht. Marianne gab es, Suzanne gab es. Leonard Cohen gibt es nicht mehr. Bei Youtube sehe ich ein langes Interview mit der schwedischen Journalistin Stina Dabrowski. Es wurde 2001 aufgenommen. Cohen ist ein alter Mann mit grauen Haaren und seltsam deformierter Nase. Nicht unbedingt schön im eigentlichen Sinne.
And your clenching your fist for the ones like us / Who are oppressed by the figures of beauty / You fixed yourself, you said “Well nevermind / We are ugly, but we have the music.”
Aber das, Chelsea Hotel #2, ist Understatement. Dabrowski erzählt, sie habe Freundinnen gebeten, ihr Fragen an ihn mitzugeben. Sie hätten alle dasselbe geantwortet: „Ask him, if he would make love to me.” Cohen lächelt wie ein alter Mann, nicht ver-, sondern überlegen. Auf diesem Gebiet sei er nicht mehr so aktiv, sagt er. „But I could always make an exception.“
So long, Marianne ist bei all der durchscheinenden Euphorie ein Abschiedslied. Die Beziehung zum entzückenden Mädchen gibt es nicht mehr. Es war schön, mit ihr gemeinsam Leonard Cohen zu hören. Aber ohne sie macht es doch irgendwie viel mehr Sinn.
Dieser Text entstand in seiner ersten Fassung im März 2016. Acht Monate später ist Leonard Cohen tot. Vielen Dank für die Songs, alter Mann.