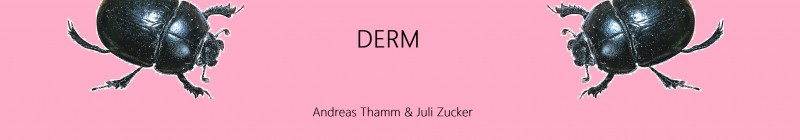Meine Mutter, am Esstisch in Palma, sagt: Ganz schön dunkel, diese Wohnung! Ganz schön hell: die Dachterrasse, der Blick aufs Meer, auf die Catedral La Seu, auf restliche Wohnungen, die sich unmittelbar in der Nähe befinden. Der Hafen: Ein Schlachtfeld von Anas und Marias. Ich sitze auf dem Beifahrersitz, wir machen eine Tour. Eine Stunde lang fahren wir im Schritttempo sieben Kilometer auf den steilsten Straßen Mallorcas rum, ohne Leitplanke, wollen Sa Calobra besichten. Uns entgegen kommend: Reisebusse voller Touristen, die nicht an uns vorbei passen. Wir also Rückwärtsgang, ich also schreiend, meine Mutter also kreidebleich. Unten angekommen haben wir direkt keine Lust mehr. Eine halbe Stunde lang stehen wir auf einem fast unbezahlbaren Parkplatz, schauen uns um, schauen nach hinten und nach vorne und beschließen nach wenigen Sekunden: Hier halten wir es nicht aus, schnell ins Auto, wieder diesen Teufelsweg entlang. Meine Mutter, oben angekommen, fertig mit den Nerven, aber nach einigen Sekunden wieder regeneriert, ist bereit fürs Cap de Formentor, den nördlichsten Punkt der Insel, weil: Wenn wir schon mal da sind! Einen Cheeseburger in Pollenca später haben wir wieder Mut gesammelt für unsere letzte Begehung, steigen ins Auto, fahren diese schnittigen Kurven mit wenigstens 20km/h entlang und sind da. Um uns herum: Nichts, Stillstand, Wasser, eine Ziege, die wie eine Gestörte die Hänge auf und absteigt. Wir bitten jemanden, ein Foto von uns zu machen, trinken ne Cola und fahren heim.
Meine Mutter, mich mit dem Mietauto von der Arbeit abholend: Wir fahren heute nach Valdemossa und essen ein Eis! Ungnädige Kälte auf dem ansteigenden Berg und jackenlos wandern wir durch ein stilles Dörfchen, schauen uns hippieske Schals an und entschließen uns beide für Stracciatella. Meine Mutter, im Gespräch mit dem Navigationssystem: Ich seh doch an den Schildern, wos lang geht! In diesem Moment empfinde ich die nie endende Liebe für diese Person. Kurze Zeit später und wieder in Palma: Die Girls, prepared for the Party. Meine Mutter und ich im Nachtleben, meine Mutter und ich auf der Piste, meine Mutter und ich im Herzen von Palma. Wir haben da nicht so viel zu suchen, verstehen nicht, wieso man so spät nachts noch so ein großes Menü bestellen kann, laufen durch die Straßen und meine Mutter begibt sich im Wahn auf die ständige Hetzjagd nach den Menschen, die ihr Geld gestohlen haben. Die Wut meiner Mutter, fast unbezwingbar. Am nächsten Tag essen wir trauernd einen Salat, bald steht ein Abschied bevor. In der letzten Nacht, in der sich meine Mutter auf der Insel befindet, schlafe ich 50 km entfernt von ihr ein.
Mama im Wagen des Schreckens
Tage später: Der erste Regen auf Mallorca. Spätsommerlich liege ich auf meiner Matratze, die Hausherrin, Ungarin und Grafikdesignerin, gerade zu Besuch in Schottland. Die Häuser stehen so nah, dass man alles von GEGENÜBER hört: Sex, Schnarchen, Fernsehgeräusche. Die Fenster sind undicht, bei Gewitter steht mein Zimmer unter Wasser. Wird schon aufhören, denke ich und gehe spazieren. Zehn Minuten von meinem Haus zum Meer, Touristenstrand. Wenn man hier ewig nach links läuft, kommt man zum Ballermann, von dem man reichlich wenig spürt in Palma. Hier sind: Menschen, die sich gerne weiß kleiden. Shops, die von Japanern betrieben werden. Und einen gibt es, mit dem ich mich im Laufe der Zeit befreunde: Einen Straßenkünstler, der ständig malen möchte. Ständig! Und immer sage ich: Nö, und immer sagt er: Ok, bis morgen. Dann: Spanisch lernen auf der Dachterrasse, mal einen Ausflug mit der wahnsinnig langsamen Eisenbahn nach Soller, mal einen Redaktionsausflug, mal mit meiner wunderbaren Freundin G. „einen drauf machen, ja!“
Ich schreibe Berichte. Über: Alcudia, die Römerstadt, Alpakas, die als Heilmittel für aufmüpfige Kinder verwendet werden, einen ERASMUS-Studenten auf Mallorca. Ich begutachte die Universität, setze mich in ein Seminar, mache Albernheiten, hier kennt mich keiner – bis ich eine Halbfranzösin im Bus kennenlerne, wo ihre andere Hälfte geblieben ist – keine Ahnung. Sie sagt mir einiges, was ich nicht verstehe, ich rede auf kläglichem Spanisch, sie auf Französisch, zwischendrin passiert nicht viel außer einem Eis mit Kokosgeschmack, klar. Wenn ich morgens zur Arbeit laufe, bin ich froh: Der Stadtplatz bereitet sich auf die Touristenflut vor, ein paar halbgeschminkte Clowns sitzen grießgrämig auf den Treppen und starren den leeren Straßen entgegen. So ist das: Ich bin gerade reich. 2000 Euro angespart und restlos ausgegeben. An einem Tag sitze ich in einem roten Touristenbus, um mich rum: Hitze, ich fahre dreimal um die Stadt, beim zweiten Mal weine ich fast ein Kind an, so stark ist der Wind hier oben. In der Fischhalle kaufe ich Avocado und Garnelen, fünf will ich haben, aber fünf wiegen nichts und können deswegen nicht abkassiert werden, dann das kleinstmöglichste, sage ich, vielleicht auf spanisch, und ich bekomme ungefähr 20. Zuhause dann: Die Garnelen zubereiten, waschen, anbraten, schälen, zwölf wegwerfen.
Am Abend gehe ich ins Reichencafé, manchmal bestelle ich ein Baguette, manchmal einen Eistee, ziemlich oft ein Bier und wenn ich mich ok fühle, dann auch einen Cocktail. Was ich da will: Internet, das gibt es in meinem Haus nicht. Die ersten Menschen, mit denen ich tagsüber rede: Diejenigen, mit denen ich Interviews über ihre Kunst mache oder diejenigen in der Redaktion oder diejenigen, die mir Tickets für Touristenattraktionen verkaufen. Ich überlege ziemlich viel und schreibe E-Mails im Café. Neben mir: Ein wohlbeleibter Anzugträger, der sich eine aus München hat einfliegen lassen. Sie will feiern, etwas unternehmen, er will eigentlich nur ins Hotel. So ist das. Im Café rauche ich Filterzigaretten und mache mir besondere Frisuren; ziemlich oft ziehe ich auch für mich eher ungewöhnliche Abendgarderobe an. Ich schreibe vereinzelt Postkarten, die meisten davon behalte ich, einmal färbe ich mir die Haare.
Irgendwann ist Maren zu Besuch, ich kenne noch nichts. Am Abend gemeinsamer Aufenthalt auf der Dachterrasse mit einem Salat, manchmal mit Eva, die sich meistens schnell wieder verflüchtigt, aber zu bestimmten Zeitpunkten auch einen Wein mitbringt. Nach meiner Arbeit treffe ich Maren am Meer, an der Bushaltestelle, in guten wie in schlechten Tagen, mit einer Mango. Einen roboterartigen Tauchausflüg später machen wir Unternehmungen, nachts, verlaufen uns, ich mache ziemlich gute Scherze mit meiner Unterwäsche, Maren lernt Erasmus-Leute kennen und bei La Seu gibt es viele Fledermäuse. Wir spielen Fußball mit einer Orange, ein Perverser will uns ECHT GERNE KENNENLERNEN. Maren: Noch brauner! Unsere Gespräche: Taxifahrer, Soller, Eva, meine Arbeit, unendlicher Spaß. Ich gehe in die Bibliothek, lese Kinderbücher auf Spanisch, Zeitungen auf Spanisch, alles auf Spanisch, nur Romane, die traue ich mich nicht. Manchmal erzähle ich einem Kellner, was ich hier mache, manchmal erzähle ich von dem Besuch meiner Mutter, manchmal interessieren sie sich, manchmal nicht, manchmal lege ich ein paar Euro in den Hut eines Musikers und manchmal schmunzle ich dabei nicht. Vorbei an Pferdekutschen, so läuft das: Der Weg nach Hause, an unzähligen Kirchen vorbei und gar nicht wissen, wo man eigentlich wohnt. Hä? Ich kaufe endlos viele Bücher. Nach ungefähr einem Monat drehe ich durch.
Wenn man sich auf einer Insel befindet, trifft man immer dieselben Menschen: Den, der vor der Kirche bettelt, die Supermarktverkäuferinnen, die wissen, dass ich immer eine bolsa brauche und mich jedes Mal über meine Tasche ärgere. Am Morgen fahren G. und ich mit Kopftüchern und Sonnenbrillen (das ist mein Ernst!) im Cabrio (das auch!) zur Arbeit, manchmal hören wir noch richtig coole Radiomusik dazu. Einmal, beim Abendessen mit einem befreundeten Pärchen, knalle ich mit dem Schädel gegen den Schrank im Flur – und das, obwohl ich mich doch heimlich aus dem Staub machen wollte! Macht nichts, aber oberpeinlich, denk ich. G. und ihr Freund heben mich auf, demnächst bitte nur noch mit Kissen rausgehen, das ist der Tipp, und als ich nach etlichem Wehklagen endlich durch die Tür geschlichen bin und um 2 Uhr nachts in einer diesen engen Gassen stehe, bei denen man nie weiß, ob man nach rechts oder links gehen soll, denke ich: Man, mir ist schwindlig. Auch schwindlig: Beim Besuch auf dem mallorquinischen Oktoberfest. Wow. Ich bin fast verzweifelt, aber die Getränke sind frei und manche, die gar nichts mit mir zu tun haben, interessieren sich für mich. Relativ früh laufen wir heim.
Ich warte auf Pia, die kann aber nicht. Auch der Rest auf dieser Insel funktioniert kaum. Und dann wieder: Einen Crepes essen! Morgens schwimmen gehen! Einen Brief schreiben! In eine Disco gehen! Mit irgendwelchen nachts an einem Bordstein sitzen! Ich halte diese Stimmungsschwankungen fast nicht aus, verbringe viele Nächte mit Büchern auf der Dachterrasse, meine Haut wird besser, sagt meine Mutter beim Besuch, Salzwasser und so, sage ich, dann trennen sich unsere Wege. In meinem Gehirn passiert vieles, vor allem: Eine Evakuation von allen Ängsten. Nachts drehe ich manchmal absolut durch. Unser Badezimmer ist rosa lackiert oder so, meine Mitbewohnerin eine fast 50-jährige Künstlerin, einmal nehme ich bei einem Malkurs teil. Gut, sagt eine Engelfrau, welch Farbwahl! Kann ich nur zurückgeben, sage auch ich. Wir lernen etwas über alles Mögliche und vor allem Farben, im Gespräch danach bin ich erschöpft. Ein sinkendes Schiff, vermutet meine Mutter per SMS. Ich kaufe einen Hut und mache Ausflüge über die ganze Insel, besichtige Römerstädte, lese viel über die Historie und lasse mich in Kunstgalerien einladen. Die meisten sind deutsch, ich finde etwas wie einen Slum und kaufe eine Cola. Komisch: So lang bin ich schon hier, keinen Deut braun geworden. Plötzlich bin ich Joggerin: So kenn ich mich gar nicht, frontal Richtung Ballermann joggend. Ich lerne einen kennen, der sagt mir etwas von einer Band, deren Name ich kenne, weswegen ich vermute, dass ich ein Fan bin. Er fliegt, sagt er, morgen nach Ibizia, von da nach Barcelona, die Flüge sind ja alle ganz günstig. Vielleicht, entschließe ich, mag ich die Band doch nicht so gern, dass ich direkt ein Konzert besuchen müsste. Meine Abreise: dramatisch, die Muttergefühle: überwältigend. Weinerliche SMS an G., unsere Hüte vermissend, aus dem Flugzeug.

Mama und ich in Valdemossa.
Meine Mutter, am Küchentisch in Regensburg sitzend, mit Lockenwicklern in den Haaren, einem halben Brötchen vor sich liegend und eine Essiggurke in der Hand, kurz nachdem ich das Haus betrete: Was hast du da gelassen? Ich, etwa drei Kilo leichter, friedfertiger, beruhigter und bei -3 Grad ohne Jacke in München angekommen, habe zum ersten Mal ATMEN können am Flughafen: endlich kalte Luft. Das Bild, das ich gemalt hab, hab ich da gelassen, ein Buch, ein Handtuch, Sonnencreme, einen Reiseführer, ein Kleid, ne Menge Kohle. Hast du einen schönen Aufenthalt gehabt, wie wars am Ballermann?, sagt einer. Danach trenne ich mich von vielem und streichle ein bisschen die Katze.